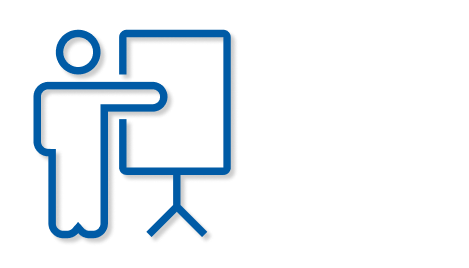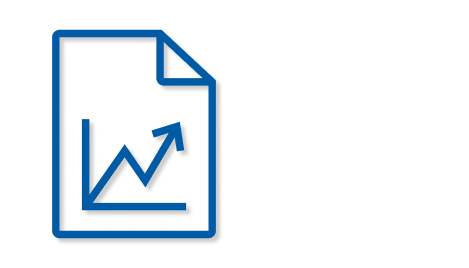VZ Analyse
Führende europäische Hersteller versuchen sich zu emanzipieren und die digitale Kontrolle über ihre Fahrzeuge zurückzugewinnen. Mit einer gemeinsamen Software-Plattform wollen sie die Abhängigkeit von den Tech-Giganten aus dem Silicon Valley verringern.
24. Juni 2025
Beschreibung
Autor: Andreas Paciorek / VZ VermögensZentrum
Nach den staatlichen Investitionsoffensiven intensiviert sich in Europa nun auch auf Unternehmensebene der Versuch, eine eigene Richtung einzuschlagen.
Ein bemerkenswerter Schulterschluss sorgt am Dienstag über die Autobranche hinaus für Aufsehen: BMW, Porsche, Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen und weitere führende europäische Hersteller und Zulieferer haben auf dem 29. Internationalen Automobil-Elektronik Kongress (AEK) eine Absichtserklärung unterzeichnet, gemeinsam eine einheitliche Software-Plattform für künftige Fahrzeuggenerationen zu entwickeln und einzusetzen. Das Ziel: Die Kontrolle über die Technik im Auto wieder selbst in die Hand nehmen — und nicht länger den Tech-Giganten aus dem Silicon Valley das Feld überlassen.
Denn die Bedrohung ist real: Google, Apple, Amazon und Co. drängen mit Macht ins Auto. Und es geht dabei nicht mehr um Motoren oder Karosserien, sondern um das eigentliche Nervensystem des Fahrzeugs: die Software.
Das Auto wird zum rollenden Computer
Heute geht es längst nicht mehr nur um Motorleistung oder Design, sondern um Software, Daten und digitale Dienste: Wer liefert die Navigation? Wer programmiert die Sprachsteuerung? Wer steuert die Kommunikation zwischen den zahlreichen Steuergeräten? Und vor allem: Wer besitzt die Daten?
Moderne Fahrzeuge sammeln permanent Informationen: Wie stark wird gebremst? Wie ist der Batteriestatus? Wo fährt der Fahrer oft hin? All diese Daten sind wertvoll – nicht nur für den Service, sondern auch für neue Geschäftsmodelle. Und genau hier setzen die Tech-Konzerne an:
- Google liefert mit Android Automotive ein komplettes Betriebssystem für das Auto – inklusive Google Maps, Sprachsteuerung und App Store.
- Apple arbeitet an einem erweiterten CarPlay, das künftig nicht nur das Display, sondern praktisch das ganze Cockpit steuert.
- Amazon bietet mit Alexa Sprachsteuerung an und mit seinem Cloud-Dienst AWS die Infrastruktur, um Fahrzeugdaten zu speichern und auszuwerten.
- Nvidia liefert hochspezialisierte Computerchips, die bei Fahrassistenzsystemen und künftig auch beim autonomen Fahren eine zentrale Rolle spielen.
Die Sorge der Autohersteller: Machtverlust
Für die Autobauer ist diese Entwicklung gefährlich. Denn wer die Software kontrolliert, kontrolliert bald auch den Kundenkontakt und die Zahlungsströme. Wenn Navigation, Sprachassistenten und personalisierte Dienste alle über Google, Apple oder Amazon laufen, geraten die Autobauer zunehmend ins Abseits. Im schlimmsten Fall bliebe den Autobauern nur noch die Rolle als austauschbarer Hardware-Zulieferer – wie es vielen Smartphone-Herstellern nach der Dominanz von Android und iOS erging.
Genau deshalb ringen viele Hersteller nun um ihre digitale Unabhängigkeit. Volkswagen investiert Milliarden in seine Software-Tochter Cariad, Mercedes-Benz arbeitet am eigenen Betriebssystem MB.OS, BMW entwickelt für seine neue Fahrzeuggeneration eine eigene Softwarebasis. Aber die Herausforderungen sind enorm.
Warum eine gemeinsame Plattform helfen könnte
Lange zögerten die Hersteller mit gemeinsamen Initiativen — zu gross war der Wunsch, sich über die Software zu differenzieren. Doch der Druck der Tech-Giganten zwingt sie nun zum Umdenken. Die nun vereinbarte Zusammenarbeit zwischen den europäischen Herstellern und Zulieferern ist deshalb so bedeutend: Gemeinsam wollen sie eine Basis-Software entwickeln, auf der alle ihre Modelle aufbauen können. So könnten die Kosten gesenkt, die Komplexität verringert und vor allem die Abhängigkeit von den Tech-Giganten reduziert werden.
Vereinfacht gesagt: Es soll eine Art „Betriebssystem-Grundlage“ entstehen, die alle Hersteller nutzen können. Darauf aufbauend könnten dann markenspezifische Funktionen, Designs und Dienste entwickelt werden. Ein BMW würde also trotzdem anders bleiben als ein Porsche – aber unter der Haube gäbe es viel mehr gemeinsame Software.
Der Digital Twin: Das Auto als digitales Spiegelbild
Eine zentrale Rolle spielt dabei der sogenannte Digital Twin – der digitale Zwilling des Fahrzeugs. Man kann sich den Digital Twin als exaktes digitales Spiegelbild des Fahrzeugs in der Cloud vorstellen: Alle Daten über den Zustand des Wagens, den Verschleiss von Teilen, den Fahrstil oder den Energieverbrauch werden in Echtzeit erfasst und analysiert.
Der Vorteil: Probleme können frühzeitig erkannt werden, Wartungen lassen sich vorausschauend planen und neue Funktionen lassen sich aus der Ferne aufspielen, ohne dass das Auto in die Werkstatt muss. Aus Sicht der Hersteller entsteht so eine dauerhafte Kundenbeziehung auch nach dem Fahrzeugkauf – ein attraktives Geschäftsmodell für wiederkehrende Umsätze.
Vom Digital Twin zum echten Auto – oder umgekehrt?
Tech-Konzerne wie Apple mussten schmerzlich erfahren, dass der Bau eines Fahrzeugs komplexer ist als die Produktion eines Smartphones: Millionen Bauteile, Sicherheitsvorschriften und Zulassungsprozesse lassen sich nicht einfach per Software lösen.
Umgekehrt tun sich Autobauer schwer, die jahrzehntelang hardwarezentrierte Entwicklung vollständig auf Software umzustellen. Projekte wie Volkswagens Cariad zeigen, wie herausfordernd es ist, agile Softwaremethoden mit industrieller Fertigung zu verbinden.
Autonomes Fahren: Wo die Tech-Konzerne führen
Besonders weit vorn sind die Tech-Unternehmen beim autonomen Fahren. Waymo, die Google-Tochter, betreibt bereits grosse Robotaxi-Flotten in mehreren US-Städten. Monatlich werden dort inzwischen über 1,3 Millionen Fahrten durchgeführt – ein grosser Vorsprung vor allen Wettbewerbern.
Auch Cruise (gehört zu General Motors) und der chinesische Anbieter Baidu Apollo sammeln umfangreiche Erfahrung mit autonomen Fahrdiensten. Der grosse Vorteil der Tech-Unternehmen liegt dabei in ihrer Stärke bei Künstlicher Intelligenz, Datenanalyse und der Fähigkeit, riesige Datenmengen auszuwerten.
Die klassischen Autobauer gehen bislang vorsichtiger vor: Mercedes-Benz bietet mit seinem „Drive Pilot“ als erster Hersteller ein Level-3-System an, das den Fahrer auf bestimmten Strecken vollständig entlasten kann – aber eben nur unter definierten Bedingungen.
Ob und wann sich vollautonome Robotaxis breit durchsetzen, ist weiterhin offen. Klar ist aber: Die Technologien, die dafür entwickelt werden – Sensoren, KI, Datenplattformen – werden schon bald in immer mehr Fahrzeugen zum Einsatz kommen.
Chinas Sonderweg: Wenn Tech und Auto verschmelzen
Besonders weit ist die Verschmelzung von Tech und Auto in China fortgeschritten. Unternehmen wie BYD oder Huawei verbinden Elektronik-, Software- und Fahrzeugbau unter einem Dach. Huawei bietet mit seinem "Huawei Inside"-System komplette Fahrzeugplattformen an, inklusive Betriebssystem, Sensorik und Fahrassistenz.
Westliche Autobauer passen sich an: BMW integriert in China künftig Huaweis Software in seine lokal produzierten Fahrzeuge, um den anspruchsvollen chinesischen Kunden digitale Dienste auf höchstem Niveau anbieten zu können.
Start-ups als Innovationsquelle
Neben den Grosskonzernen spielen Start-ups eine wichtige Rolle im Rennen um die Mobilität der Zukunft. Hersteller sichern sich frühzeitig Beteiligungen an innovativen jungen Unternehmen, um sich neues Know-how zu sichern.
Beispiele sind General Motors mit Cruise, Hyundai mit Motional oder die chinesischen Newcomer NIO, Xpeng und Li Auto. Allerdings zeigt sich auch: Nicht jedes ambitionierte Start-up schafft den Sprung in die Serienproduktion. Fahrzeugbau bleibt selbst für gut finanzierte Jungunternehmen eine kapitale Herausforderung.
Verschiedene Strategien in den Weltregionen
- Europa setzt auf Kooperation zwischen den Herstellern, um gemeinsame Standards zu schaffen und die Kontrolle über die Technologie zu behalten.
- Die USA profitieren von der Nähe ihrer grossen Tech-Unternehmen. Google, Amazon, Apple und Nvidia spielen auf dem heimischen Markt eine zentrale Rolle, während die Autobauer versuchen, mit eigenen Softwareinitiativen Anschluss zu halten.
- China führt die engste Verschmelzung von Tech und Auto vor: Dort entstehen komplette Plattformanbieter, die sowohl Hardware als auch Software aus einer Hand liefern.
Was heisst das für Anleger?
Für Anleger entsteht ein neues Bewertungsparadigma: Klassische Kennzahlen der Automobilindustrie verlieren an Bedeutung, während wiederkehrende Software-Erlöse, Plattformeffekte und Datenmonetarisierung zum zentralen Treiber der Bewertung werden.
Gewinner werden jene Unternehmen sein, die erfolgreich den Brückenschlag zwischen Hardware-Kompetenz und Software-Steuerung meistern. Das Rennen ist eröffnet — und längst nicht entschieden.