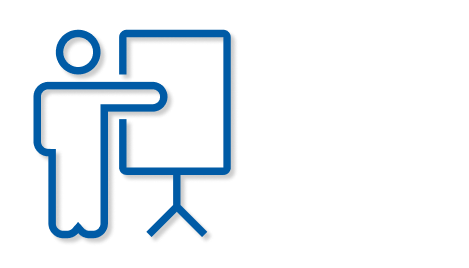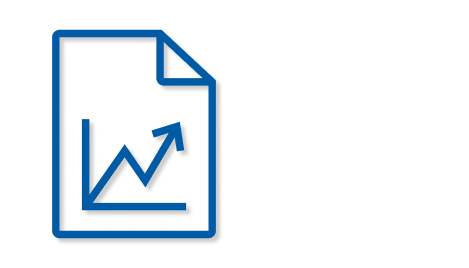VZ Analyse
Der S&P 500 und der Nasdaq 100 erzielen neue Bestmarken. Nur dem Dow Jones fehlen noch ein paar Prozent zu einem Allzeithoch. Woran liegt das?
27. Juni 2025
Beschreibung
Diesen Mittwoch erreichte der Nasdaq 100 mit 22'329 Punkten einen neuen Rekordstand – nur 79 Tage nach seinem markanten Tiefpunkt vom 7. April, als der Index infolge der zollpolitischen Massnahmen unter Präsident Trump kurz nach dem "Liberation Day" auf 16'542 Punkte gefallen war. Die darauffolgende Erholung war ebenso schnell und kraftvoll. Zuvor hatte der Nasdaq 100 am 19. Februar mit 22'222 Punkten letztmals ein Allzeithoch erreicht.
Auch der S&P 500 zeigte ein ähnliches Muster: Nach einem markanten Tief am selben Tag legte er über 27 Prozent zu und egalisierte damit sein vorheriges Allzeithoch.
Im Gegensatz dazu verläuft die Entwicklung des Dow Jones Industrial Average deutlich verhaltener. Zwar befindet sich auch dieser Index in einem Aufwärtstrend, doch mit einem Rückstand von 3.3 Prozent auf sein bisheriges Hoch bleibt er spürbar hinter der Dynamik von Nasdaq 100 und S&P 500 zurück – ein Unterschied, der nicht zuletzt auf die unterschiedliche Indexstruktur und Gewichtungsmethodik zurückzuführen ist.
Berechnung der einzelnen Indizes
Der Nasdaq 100 umfasst die 100 grössten Unternehmen, die an der Nasdaq-Börse gelistet sind und nicht der Finanzindustrie angehören. Die Gewichtung erfolgt auf Basis der Marktkapitalisierung, jedoch unterliegt sie bestimmten Einschränkungen. Um eine übermässige Dominanz einzelner Titel zu vermeiden, wird der Index quartalsweise angepasst. Dabei wird sichergestellt, dass kein einzelnes Unternehmen mehr als 24 Prozent des Gesamtgewichts ausmacht und dass die Summe aller Unternehmen mit einem Anteil von über 4.5 Prozent zusammen nicht mehr als 48 Prozent beträgt. Diese Regelung wurde eingeführt, um die Marktmacht von starkgewichteten Unternehmen zu reduzieren.
Der S&P 500 umfasst die 500 grössten börsennotierten US-Unternehmen, ebenfalls gemessen an ihrer Marktkapitalisierung. Die Auswahl erfolgt durch ein Komitee von Standard & Poor’s, das regelmässig überprüft, ob Unternehmen Kriterien wie ausreichende Liquidität, einen bestimmten Börsenwert sowie den Unternehmenssitz in den USA erfüllen.
Die Gewichtung im Index basiert auf der Streubesitz-Marktkapitalisierung – das heisst: Je höher der Börsenwert eines Unternehmens, unter Berücksichtigung ausschliesslich der frei handelbaren Aktien, desto grösser ist sein Einfluss auf den Index. Zwar gibt es keine feste Obergrenze für die Gewichtung einzelner Titel, doch dominiert eine kleine Gruppe von technologienahen Unternehmen wie Apple, Microsoft, Amazon und Nvidia den Index mit einem erheblichen Anteil.
Der Dow Jones ist der älteste der drei Indizes und besteht aus nur 30 grossen US-Unternehmen. Im Gegensatz zu den anderen beiden Indizes basiert seine Berechnung nicht auf der Marktkapitalisierung, sondern auf dem Aktienkurs der enthaltenen Unternehmen. Das bedeutet, dass ein Unternehmen mit einem hohen Aktienkurs einen grösseren Einfluss auf den Index hat als ein Unternehmen mit einem niedrigeren Kurs, selbst wenn Letzteres eine höhere Marktkapitalisierung hat. Diese Methode kann zu Verzerrungen führen, weshalb der Dow Jones oft als weniger repräsentativ für den Gesamtmarkt gilt.
Einzelpositionen machen den Unterschied
Durch die geringe Anzahl an Einzeltiteln ist der Dow Jones Industrial Average deutlich anfälliger für Kursschwankungen von einzelnen Unternehmen. Seit Ende März war es insbesondere UnitedHealth, das den Index mit einem Kursverlust von fast 42 Prozent stark belastete. Der Grund dafür liegt, wie bereits erwähnt, in der preisgewichteten Struktur des Index. UnitedHealth notierte Anfang April bei 523 US-Dollar und fiel bis zum 26. Juni auf 302 US-Dollar – ein drastischer Rückgang, der sich aufgrund des hohen Aktienkurses überproportional auf den Index auswirkte.
Positiv wirkte hingegen Nvidia, dessen Kurs im gleichen Zeitraum von 110 auf 155 US-Dollar stieg. Aufgrund der vergleichsweisen niedrigeren Kursnotierung fiel dieser Anstieg jedoch weniger stark ins Gewicht. Anders stellt sich die Situation bei den marktkapitalisierten Indizes Nasdaq 100 und S&P 500 dar. Dort konnte Nvidia dank seiner hohen Gewichtung den Index deutlich stärker antreiben, während die negative Entwicklung von UnitedHealth besser abgefedert wurde.
Ein grosses Aber für den Schweizer Anleger
Anzumerken ist, dass die zuvor dargestellten Entwicklungen in US-Dollar berechnet wurden. Rechnet man jedoch in Schweizer Franken, ergibt sich ein deutlich anderes Bild. Seit der von Trump ausgelösten Zollthematik hat die Unsicherheit an den Finanzmärkten spürbar zugenommen. In solchen Phasen steigt traditionell die Nachfrage nach sicheren Häfen – und der Schweizer Franken hat sich einmal mehr als ein solches bewährt.
Seit Anfang April hat der Franken gegenüber dem US-Dollar um über 10 Prozent aufgewertet. Diese Währungsentwicklung muss bei der Interpretation der Marktentwicklung berücksichtigt werden. So liegt der S&P 500 seit seinem Tiefpunkt am 7. April in US-Dollar gerechnet zwar 21,6 Prozent im Plus, in Schweizer Franken beträgt dies jedoch lediglich 13,2 Prozent.
Die Möglichkeit eines Kursrücksetzers ist derzeit durchaus gegeben. Einerseits bieten neue Allzeithochs stets Anlass für Gewinnmitnahmen, andererseits steht mit dem Ende der Aussetzung der reziproken Zölle am 9. Juli ein potenziell marktbewegender Termin bevor. Auch im Falle erneuter Marktschwankungen bleibt eine langfristige Anlagestrategie die verlässlichere Herangehensweise – denn historisch betrachtet erweist sich ein kontinuierliches Engagement am Markt als erfolgreicher als der Versuch, kurzfristige Entwicklungen vorherzusagen.